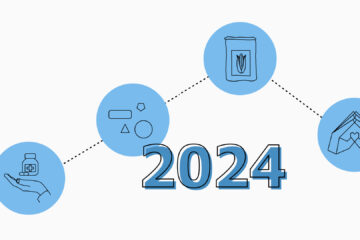Es war kurz vor 9 Uhr abends als ich mit einem kribbelnden Gefühl im Bauch und einem 15 kg schweren Rucksack auf dem Rücken aus der Schnellbahn S7 Richtung Flughafen Schwechat ausstieg und mir voller Vorfreude meinen Weg Richtung Check-In-Schalter bahnte. Knappe 10 Stunden und 5.846 km später war ich endlich da: im Herzen Ost-Afrikas, in Nairobi. Jene Stadt, die liebevoll “Green City in the Sun“ (übersetzt: die grüne Stadt in der Sonne) genannt wird.
Die pulsierende Landeshauptstadt Kenias, Wohnort von über 5 Millionen Menschen, Hauptsitz zahlreicher unterschiedlicher UN-Organisationen und Welthauptstadt der Tierwelt. Dieser Name wurde der Stadt verliehen, da es sich bei Nairobi um die weltweit einzige Großstadt handelt, die einen Nationalpark innerhalb der Stadtgrenzen besitzt. Hier tummeln sich über 100 verschiedene Arten von Säugetieren, inklusive Büffel, Giraffen, Löwen, Leoparden, Paviane, Zebras oder Geparden, die auf endlosen Weiten grasen oder sich im Schatten großer Akazienbäume ausruhen.
Doch unweit von dieser unberührten Natur findet man eine andere Art von Wildnis: Im Südwesten der Stadt, knappe 3,3 km abseits des Haupteingangs des Nairobi Nationalparks und nur eine halbe Stunde Autofahrt entfernt vom Central Business District – dem Geschäftsviertel Nairobis – befindet sich Kibera. Das Viertel, welches sich ironischerweise direkt neben dem luxuriösen Royal Nairobi Golf Club befindet, ist der größte Slum Afrikas und der drittgrößte Slum der Welt. Der Name des Viertels stammt von dem Wort „Kibra“ ab, was auf Swahili so viel wie Dschungel oder Wald bedeutet. Die exakte Einwohnerzahl ist nicht bekannt, aber unterschiedlichen Schätzungen zufolge sollen dort zwischen 200.000 bis zu knapp zwei Millionen Menschen leben. Zwischen offenen Abwasserkanälen, Hütten aus Lehmwänden und Wellblechdächern, Bergen aus Plastikmüll, Hühnern, Ziegen und spielenden Kindern, findet man Menschen, deren Geschichten mich berührt und bewegt haben.

Viele dieser Geschichten starten im Tages- und Therapiezentrum der Child Destiny Foundation, welches sich auf einer der wenigen gepflasterten Straßen am Rande von Kibera befindet. Auf diesen Straßen tobt das Leben. Man sieht Auto- und Motorradfahrer, die sich langsam und hupend den Weg durch die Menschenmassen bahnen, Leute in Anzügen und formeller Arbeitskleidung, die kilometerlange Arbeitsweg zurücklegen, sowie auch Händler und Ladenbesitzer, die ihre Ware zur Schau stellen und auf kaufwillige Kunden warten. Außerdem trifft man auf Kinder in Schuluniform, die mit einem großen Rucksack bepackt in Richtung Schulgebäude gehen. Männer, die Schubkarren voller Wasserkanister vor sich schieben. Frauen bereiten auf offenen Feuerstellen Mandazi und andere kenianische Köstlichkeiten zu, die sie direkt vor Ort zum Verkauf anbieten. Inmitten dieses ganzen Trubels findet man auch Mütter von Kindern mit Behinderung, die sich zur Child Destiny Foundation begeben. Manche von ihnen kommen zu Fuß, das Kind in einem bunten Baumwolltuch an den Rücken gebunden, andere hingegen auf dem Motorrad, mit einem oder mehreren Kindern im Schlepptau. Meist sind sie zu dritt auf einem Motorrad, was in Österreich natürlich nicht erlaubt wäre. Hier jedoch ist es für viele Mütter der Child Destiny Foundation Alltag und oft die einzige Möglichkeit, um das Kind ins Zentrum bringen zu können. Denn einige von ihnen, vor allem jene, die schon von Anfang an dabei waren, sind mittlerweile zu alt, zu groß und zu schwer, um noch von ihren Müttern getragen zu werden. Und da viele dieser Kinder in ihrer eigenen Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind, zu spastischen Muskelverkrampfungen neigen und Gleichgewichtsstörungen haben, bleibt den Müttern keine andere Möglichkeit, als auf die Hilfe von Dritten angewiesen zu sein. Ein Auto oder ein eigenes Fahrzeug ist hier purer Luxus, den sich in Kibera nur die wenigsten leisten können. Allein einen Führerschein zu besitzen, ist mit ungeheurem Aufwand und Kosten verbunden. Die Fahrschule kostet umgerechnet 100-200 EUR, dazu kommen noch die Kosten für die Ausstellung der Dokumente und natürlich braucht man noch ein eigenes Fahrzeug, was Benzin-, Zulassungs- und Instandhaltungskosten bedeutet. Als Taglöhner ist dieser finanzielle Aufwand ein fast unüberbrückbares Hindernis.
Und so warten die Mütter jeden Morgen vor der eigenen Haustür darauf, dass ein Fahrer vorbeikommt und ihre Kinder bei jeder Witterung zum Tageszentrum führt – egal ob bei 40 Grad Sommerhitze, Hagel oder Regen.
Und da die Strecken nicht immer leicht zu befahren sind, teilweise sehr steil und uneben, sind diese Motorradfahrten auch nicht ganz ungefährlich. Aber dennoch sind die Mütter dankbar für den Service, denn sie wissen, dass sie ohne diese Hilfe auf sich allein gestellt wären und keine Möglichkeit hätten, einem geregelten Tagesablauf oder einem Job nachzugehen. Wenn das pflegebedürftige Kind zu Hause ist, muss man sich als Elternteil um den Sprössling kümmern und ihn auf Schritt und Tritt begleiten, sei es beim Essen, beim auf die Toilette gehen, beim Schlafengehen oder beim Spielen. Tag und Nacht muss man auf Abruf bereit sein und die eigenen Bedürfnisse für die Pflege des geliebten Kindes zurücksetzen.
So geht es zum Beispiel der Mutter von Owen, die aufgrund der schlechten Erreichbarkeit ihres Wohnhauses, nicht in der Lage ist, Owen zum Tageszentrum zu bringen. Der mittlerweile 15-jährige Sohn ist zu schwer, damit sie ihn durch die engen Schlammwege, die den Weg durch den Slum kennzeichnen, tragen könnte. Schaut man einmal nicht auf den Boden, kann es vorkommen, dass man in ein Loch, einen Graben oder in Teile der Kanalisation fällt. Was für mich teilweise ein schwer zu beschreitender Weg war, ist für eine Frau mit einem mehr als 40 Kilo schweren Kind im Huckepack völlig undenkbar. Und so bleibt sie zu Hause, kümmert sich um ihren Sohn und wartet auf den Ehemann, der am Ende des Arbeitstages den Lohn bringt. Gesellschaft leisten ihr ihre weiteren zwei Kinder, die das kleine Haus mit Gelächter und Geschrei erfüllen. Aber auch Owen ist kein stilles Kind – der charismatische Bub mit strahlenden Augen weiß, wie man Fremde zu Freunden macht und Menschen um den Finger wickelt. “I want a red car“ – das war einer der ersten Sätze, die mir Owen bei meinem Besuch an einem lauen Montagvormittag mitgeteilt hatte. Ein Auto, um den täglichen Weg ins Tageszentrum zurücklegen zu können. Ein Auto, um der Mutter eine Last abzunehmen. Ein Auto, um die Freunde im Zentrum wieder öfters sehen zu können. Ein Auto, um in der Lage zu sein, ein autonomes Leben zu führen. Und rot, naja, das ist einfach seine Lieblingsfarbe, erklärt mir die Mutter. Doch was wie ein plausibler und nachvollziehbarer Wunsch klingt, ist leider nicht realisierbar. Denn auch ein Auto würde bei den unpassierbaren Straßen im Slum nichts bringen. Man kann kaum mit einer Schubkarre die Wege bewältigen, geschweige denn mit einem Fahrzeug. Daher wünscht sich die Mutter nichts sehnlicher, als endlich umzuziehen und eine Bleibe an einer asphaltierten Straße zu haben, um den Sohn wieder regelmäßig ins Tages- und Therapiezentrum bringen zu können. Doch eine solche Wohnstätte kostet viel Geld. Weitaus mehr als die ca. 25 EUR Monatsmiete, die eine Familie durchschnittlich in Kibera für eine Blechhütte zahlt. Und daher hofft und betet Mama Owen, dass sie durch die Unterstützung der Child Destiny Foundation dieses Lebensziel irgendwann erreichen kann, damit die Familie endlich einem selbstbestimmten Alltag fern von logistischen Einschränkungen leben kann.
Text und Fotos von Elisa Fabrizi